Gerhard Stahl lehrt in China und hat für das Bundesfinanzministerium gearbeitet. Im Interview spricht er unter anderem darüber, was er an der öffentlichen Diskussion über das große Land für problematisch hält und was die westliche Welt von China lernen kann.
Herr Stahl, Sie sind 2014 als Hochschullehrer an die Peking University HSBC Business School nach Shenzhen gekommen. Wie würden Sie in wenigen Worten jemandem China beschreiben, der das Land nicht kennt?
Gerhard Stahl: China ist kein Land, sondern ein Kontinent: Sehr groß, sehr vielfältig. Es gibt 17 Klimazonen, von der mongolischen Grenze bis auf die Insel Hainan ins südchinesische Meer. Auf dem Land ist das Leben noch fast mittelalterlich, dafür sehr modern in den Stadtzentren. Es hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie weit China schon technologisch voraus ist.

Shenzhen ist das Silicon Valley Chinas. Wie kann man sich die Stadt vorstellen?
1978 war Shenzhen noch ein Fischerdörfchen. Es war die erste Sonderwirtschaftszone, die der ehemalige Parteiführer Deng Xiaoping eröffnete. Er wollte das Land wirtschaftlich weiterentwickeln. Inzwischen ist Shenzhen eine moderne Metropole mit Hochhäusern, U-Bahnen, vier- bis fünfspurigen Autostraßen. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich Shenzhen zu einer Weltmetropole entwickelt. Früher legte sie ihren Fokus auf die Industrieproduktion, inzwischen ist Shenzhen eine Dienstleistungsstadt, man findet dort kaum noch Fabriken. Shenzhen ist ein Symbol für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas.
Während Corona ist der Präsenzunterricht weggefallen. Ihre Kurse fanden digital statt. Wie sah Ihr Hochschulalltag vor Corona aus?
Ich unterrichte in einem Masterprogramm auf Englisch. Der Kurs heißt „Transition Economics”, darin geht es um den Übergang von der Plan- in die Marktwirtschaft. Es ist ein toller Kurs, der mir erlaubt, mich mit der chinesischen Wirtschaft auseinanderzusetzen. Die Programme an der Universität sind international akkreditiert, man unterrichtet das amerikanische Wirtschaftsverständnis. Gleichzeitig ist die Business School Bestandteil der Peking Universität, der ältesten Staatsuniversität Chinas. So tragen auch chinesische Professoren dazu bei, den Sozialismus mitzuentwickeln. Ich fand das sehr spannend. Auf den ersten Blick könnte man meinen, das passt gar nicht zusammen, aber im Alltag einer internationalen Business School wurde es vereinbar gemacht.
Haben Sie Beispiele?
Das lässt sich am Beispiel von wissenschaftlicher Literatur sehen. Es gibt internationale Lehrbücher, die meisten sind amerikanisch geprägt, die vom alten Wirtschaftsverständnis ausgehen. Und es gibt Lehrbücher, die sagen, dass Marktwirtschaft und ein politisches System, welches von einer Partei dominiert wird, nicht vereinbar sind. Ich komme in meiner Analyse zu einem anderen Schluss: Die Art, wie die chinesische Politik mit den internationalen Herausforderungen umgeht, muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass das politische System sich verändert. Wenn ich nun Bücher in meinem Kurs habe, die sagen, Marktwirtschaft und ein Einparteiensystem passen nicht zusammen, dann ist es naheliegend, dass die Zentrale der Peking-Universität Probleme mit der Literatur hat. 2017 wurde eingeführt, dass die Literaturempfehlungen von der Zentrale angeschaut werden. Es hieß, es handle sich um eine Qualitätskontrolle. Sicherlich war damit auch eine gewisse politische Kontrolle verbunden. Die Lösung war schließlich, dass ich keine bindende Literaturliste herausgebe, sondern lediglich Literaturempfehlungen. Damit konnte ich die Freiheit der Lehre behalten.
Wie gut ist ihr Chinesisch?
Mein Chinesisch ist rudimentär. Es ist eine schwierige Sprache. Man versteht im Laufe der Jahre immer mehr, aber es ist mir nicht gelungen, eine ausreichende Sprachfertigkeit zu erlangen.
Der Titel Ihres Buches lautet: “China: Zukunftsmodell oder Albtraum, Europa zwischen Partnerschaft und Konfrontation”. An was denken Sie bei den Wörtern Zukunftsmodell und Albtraum?
Man sollte das Buch nicht nur über den Titel wahrnehmen. Der Titel ist sicherlich auch einem gewissen Interesse geschuldet, dass im Moment die China-Diskussion sehr zugespitzt ist. Dabei sehe ich das Risiko, dass wir zunehmend in eine Lagerdiskussion verfallen. Das eine Lager hält China für gefährlich und autoritär, das andere für wirtschaftlich so erfolgreich, dass es naiv als unhinterfragtes Zukunftsmodell sieht. Ich wollte mit dem Buch eine kurze Einführung für diejenigen geben, die China noch nicht im Detail kennen. Und ich wollte aus dieser eben beschriebenen vereinfachten Sichtweise herauskommen. Wir können einen informierten und vorurteilsfreien Blick auf China entwickeln. Die Entwicklung in China betrifft uns in massiver Weise. Wenn sich ein Fünftel der Menschheit in ein internationales Wirtschaftssystem integriert, wird das Auswirkungen haben. Deswegen muss man sich damit auseinandersetzen, was in diesem riesigen Land passiert. Bedauerlich ist, dass bei dieser Auseinandersetzung nicht immer die notwendige Sachkenntnis einfließt, sondern die ideologische Brille. Dadurch wird die Debatte verkürzt.
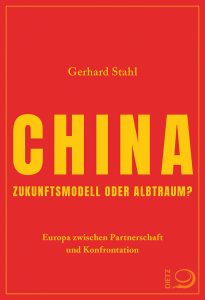 Stört Sie die verkürzte Debatte?
Stört Sie die verkürzte Debatte?
Ja. Es gibt einen guten Indikator dafür, ob in einem Land die Entwicklung als positiv oder negativ erlebt wird und das ist die Freizügigkeit. Nach wie vor ist es der Wunsch chinesischer Familien, dass ihre Kinder im Ausland studieren. Sie können selbst entscheiden, ob sie in dem fremden Land bleiben wollen. Doch die meisten Austauschstudenten kommen wieder zurück, weil sie für sich Entwicklungschancen in China sehen. Das hat auch damit zu tun, dass China in vielen Bereichen noch ein Entwicklungsland ist und jetzt eine dynamische, wirtschaftliche Entwicklung erlebt, die entwickelte wie unsere westlichen Länder schon lange hinter sich haben.
Die Fünf-Jahres-Pläne, die die Kommunistische Partei festlegt, wie starr oder flexibel sind diese Pläne?
Sie waren ein Instrument, das von der ehemaligen Sowjetunion entwickelt und von Mao übernommen wurde. Allerdings war es eine Tonnenideologie, die keine leistungsfähige Wirtschaft produzierte. Unter Deng Xiaoping haben die Chinesen die sowjetische Planwirtschaft durch eine sozialistische Planwirtschaft ersetzt. Inzwischen ist es ein Instrument der strategischen Planung, die eine breite Konsultation voraussetzt. Wir denken immer, dass die Zentrale in Peking die Politik bestimmt. Wir übersehen aber, dass es ein sehr dezentralisiertes Land ist, es bedarf eines hohen Abstimmungsbedarfes.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass die Chinesen sich mit dem Ausland beschäftigen, sowohl in der Politik als auch in den Unternehmen. Sie lesen Bücher über andere Länder, sie informieren sich. Macht das die westliche Welt mit China auch?
Wir haben oft noch diese historische Arroganz. Europa hat in vielen Jahrhunderten als Kolonialakteur die Welt bestimmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der dominierende Einfluss der USA hinzu, der dazu geführt hat, dass es uns selbstverständlich schien, dass die Entwicklung technologischer und gesellschaftlicher Art im Westen stattfindet. Uns fällt es noch schwer zu akzeptieren, dass sich der wirtschaftliche Schwerpunkt vor allem nach Asien verschoben hat. Dort leben fünf Milliarden Menschen, die Europäische Union macht mit ihren 450 Millionen ungefähr sechs Prozent der Weltbevölkerung aus, Deutschland gerade mal ein Prozent. Wir sollten akzeptieren, dass wir auch von anderen lernen können. Ich denke, dass es in der politischen Diskussion und auch in der Öffentlichkeit Nachholbedarf gibt, Dinge differenzierter zu sehen.
Sie haben sich mit vielen Chinesen unterhalten. Was ist Ihr Eindruck?
Die Alltagsrealität in China ist sehr unterschiedlich. In Shanghai, Shenzhen und anderen Großstädten gibt es viele wohlhabende Chinesen, die regelmäßig ins Ausland reisen, zum Teil dort auch Immobilienbesitz haben. Das hat mich insofern überrascht, weil es bei den Kapitalverkehrskontrollen gar nicht so einfach ist, sein Geld ins Ausland zu bringen. In den Städten gelten andere Regeln als in den Provinzen im Landesinneren. In den Städten wohnt eine offene, der Welt zugewandte Gesellschaft. Im Landesinneren gibt es Konflikte mit Minderheiten, die Debatten über Polizeistaat und Überwachung entfachen.
China hält an seiner Zero-Covid-Politik fest. Was bedeutet das für Länder, die mit China Geschäfte machen?
Corona war ein ökonomischer Schock. Die Covid-Politik Chinas hat dazu beigetragen, dass die Lieferkettenprobleme noch verstärkt wurden. Was im Verständnis über China noch wichtig ist: Es ist nicht nur ein System, das mit besonderer Härte gegen persönliche Interessen vorgehen kann, sondern es gibt auch objektive Gründe, warum China eine andere Covid-Politk durchführen muss: Schaut man sich die Gesundheitsversorgung in China an, ist das Gesundheitssystem noch sehr unterentwickelt. China gibt sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus, im Vergleich dazu geben die USA 13 Prozent aus. China hat große Schwierigkeiten, wenn eine Pandemie auftaucht. Dort gilt das Haushaltsregistrierungssystem (Hukou). Es ist das wichtigste Dokument für einen Chinesen und bestimmt, wo er sich aufhalten kann und welche Rechte ihm zustehen. Wer auf dem Land geboren wurde, erhält einen ländlichen Hukou, wer in der Stadt geboren wurde, einen städtischen Hukou. Die Gesundheitsversorgung steht einem Chinesen wegen seines Hukous deshalb nur in seiner Heimatgemeinde zu.
Ein Land ohne ausreichende Gesundheitsversorgung, aber mit 200 Millionen Wanderarbeitern, die in den Ballungszentren arbeiten, muss daher ganz anders reagieren. Denn bei ernsthafter Krankheit müssen die Wanderarbeiter wieder zurück in ihre Heimatgemeinde, um dort gesundheitliche Leistungen in Anspruch nehmen zu können. So breitet sich eine Pandemie sofort aus. Insofern ist unter diesen Bedingungen eine sehr viel härtere Lockdownpolitik nachvollziehbar, weil das Gesundheitssystem gar nicht in der Lage ist, mit größeren Krankheitsfällen umzugehen.
Setzen wir mit unserer Kritik an China die falschen Maßstäbe?
Man kann mit Sicherheit Kritik üben. In den chinesischen sozialen Medien wurde während der Lockdowns sehr viel Kritik geübt. Es gab auch absurde Szenen, einzelne Stadtverwaltungen haben völlig daneben reagiert. Man muss aber auch sehen, dass die Ausgangsvoraussetzungen ganz anders sind als in den entwickelten Ländern.
Ist China nach Corona ein anderes als vor Corona?
Das glaube ich nicht. Ich würde eher die Frage stellen: Wird China ein anderes Land im Hinblick darauf, dass der Westen, insbesondere die USA, China als Gefahr sehen? In den USA gibt es einen Parteienkonsens, der China eindeutig als Gefahr für den Weltfrieden und als Bedrohung für die Vereinigten Staaten definiert. Ich erinnere an die Mahnung von Henry Kissinger: “Wer eine aggressive Rhetorik betreibt, muss damit rechnen, dass diese dann auch aufgegriffen wird.” Meine Erfahrungen in China zeigen mir, dass es dort einen Großteil der Bevölkerung gibt, der sehr offen ist, alle Vorteile einer internationalen Wirtschaft wahrnimmt, sich in Frieden entwickelt und daran auch nichts ändern möchte. Sie wollen weder eine Konfrontation noch eine militärische Auseinandersetzung. Den Chinesen ist es in einem geschickten Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft und zunehmender Öffnung des Marktes gelungen, sich in einer schrittweisen und überlegten Öffnung im internationalen Wettbewerb durchzusetzen.
Gleichzeitig erleben wir in der Taiwan-Frage, wie schnell militärisches Säbelrasseln und militärische Kalküle eine Konfrontation zwischen Ländern bestimmt. In China gibt es auch Menschen, die sagen, wir müssen uns schützen, wir brauchen das Gewehr. Viele haben ihre kommunistische Vergangenheit noch nicht vergessen. Deswegen ist es auch nicht auszuschließen, dass militärische Überlegungen zunehmen, wenn man sich militärisch bedroht sieht.
Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses der USA, ist nach Taiwan geflogen. Biden war nicht dafür, hat es ihr aber auch nicht verboten. Das amerikanische Militär riet davon ab. Ist das ein Beispiel für Sie, dass China reagieren musste, was Xi Jinping gegenüber Biden auch androhte?
Taiwan ist ein interessantes Beispiel für die Risiken einer China-Politik, die stärker von einer innenpolitischen Debatte geprägt ist, als von einer gut austarierten Außenpolitik. 1971 beschlossen die UN, dass die Regierung der Volksrepublik China vertrete. Mit dem Besuch Richard Nixons 1972 bei Mao Tsetung, hat China die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion beendet und angefangen, sich an Amerika zu orientieren. 1979 erkannten die USA die Volksrepublik als legitime Vertretung des chinesischen Volkes an und nicht Taiwan (Republik China), wo die Regierung die Vertretung für Gesamtchina ebenfalls für sich beanspruchte. Wir haben also eine Situation, in der wir akzeptiert haben, dass Taiwan zu China gehört, was den Namen Ein-China-Politik trägt.
Fahrlässig ist, die Situation der Ukraine mit Taiwan gleichzusetzen. Denn die Ukraine ist ein unabhängiges Land, welches vom Nachbarn überfallen wurde. Lange Zeit gab es in Taiwan insofern kein Problem, weil ein Großteil der Bevölkerung sich als Chinesen verstanden hat. Seit 1990 entsteht dort eine demokratische Gesellschaft, die sehr offen ist und sich anders entwickelt als die Volksrepublik. In Taiwan nehmen die Stimmen zu, die sich eine Unabhängigkeit wünschen. Es gibt auch amerikanische Politiker, die jetzt sagen, dass man die Ein-China-Politik aufgeben muss. Das würde aber heißen, dass man den internationalen Status Quo verändert. Das erklärt auch, warum China so massiv reagiert. Die chinesische Regierung hat das Gefühl, dass etwas, was zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt anerkannt wurde, also dass Taiwan zu China gehört, dass diese Anerkennung aufgekündigt wird.
Was wünschen Sie sich für die zukünftigen Beziehungen zwischen China und der westlichen Welt?
Ich wünsche mir, dass wir viel stärker die Entwicklung der städtischen Gesellschaft in China in den Blick nehmen. Es gibt eine große städtische Mittelschicht. Dies sehen Sie zum Beispiel an 40 Millionen Chinesen, die Klavier spielen. Ein deutscher Klavierbauer wurde von einem chinesischen Staatsunternehmen übernommen. Sie haben eine eigene Klavierproduktion aufgebaut, weil sich die städtische Mittelschicht in China kulturell verändert. So etwas assoziieren wir eigentlich mit dem Westen. Wir sollten stärker im Blick haben, wie Teilhabe an einer internationalen Welt und Wirtschaft es möglich macht, gemeinsame Interessen und kulturelle Werte aufzubauen. Das kommt in der Diskussion zu kurz.
Was hat Sie in China am meisten beeindruckt?
Am meisten hat mich das Interesse der Chinesen aus der Mittelschicht beeindruckt an dem, was außerhalb Chinas vorgeht. Die hohe Wertschätzung der Entwicklung außerhalb Chinas kann man an simplen Dingen sehen: In den Einkaufszentren der großen Städte gibt es überall Luxusprodukte aus der westlichen Welt zu kaufen. Um einen Film in China zu zeigen, braucht man zwar eine Genehmigung. Aber die amerikanischen Blockbuster waren die Filme, die am meisten besucht wurden. China hat inzwischen eine eigene Filmindustrie aufgebaut, auch um chinesische Bilder und Werte stärker in die Öffentlichkeit zu bringen.
Was können wir von den Chinesen lernen?
China hat mit dem System, dass Politik und Wirtschaft eng zusammenarbeiten, eine gute Basis, um die vierte industrielle Revolution strategisch anzugehen. Auch müssen wir einen Teil unserer etablierten Denkmuster korrigieren. Wir haben eine bestimmte Idee der Marktwirtschaft entwickelt. Sie passte zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt mit Spielregeln für eine westlich dominierte, internationale Wirtschaft. Damals konnten wir sagen, wir brauchen keine staatliche Einflussnahme, Unternehmen müssen effizient sein.
China zeigt auch, dass Militär und Wirtschaft zusammengehören. Das hören wir als Deutsche nicht gerne. Aber Innovation wird auch durch militärische Forschung in Gang gesetzt. Das ist in den USA keine Neuheit. Dort gibt es schon seit langem Entwicklungen, die militärisch angestoßen wurden und das Militär ist dann Bestandteil der Industriepolitik. Da ist unsere deutsche Nachkriegstradition sehr anders. Wir wollen nicht, dass das Militär eine zu große Rolle spielt, das ist unser Erbe. Im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sehen wir, dass man wieder strategisch stärker in Militärkategorien denken muss.
Buch: Gerhard Stahl, „China: Zukunftsmodell oder Albtraum: Europa zwischen Partnerschaft und Konfrontation“

